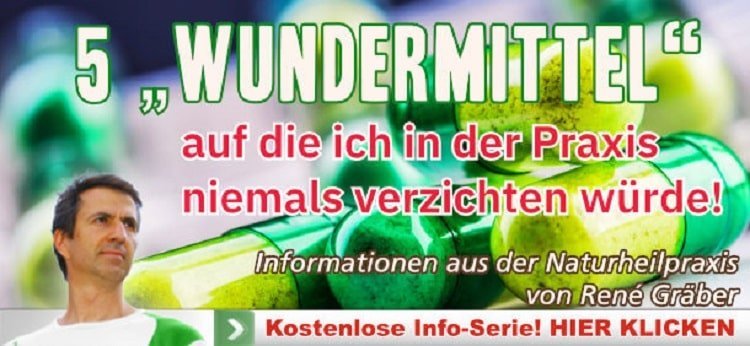Fasten beinhaltet, eine gewisse Zeitlang völlig freiwillig auf jede feste Ernährung zu verzichten. Fastete man früher häufig aus eher religiösen Motiven, so spielt heutzutage das Ziel von positiven gesundheitsfördernden Erfolgen aber auch die Reduktion des Gewichts eine dominierende Rolle.
Jeder der sich entschließt mal den Versuch des Heilfastens zu machen, kann sich individuell für einen „Fastenfahrplan“ entscheiden. Wichtig für den Erfolg, ist ein angenehmes und entspanntes Umfeld, das viele heute nur im Urlaub gewinnen können. Sehr wichtig auch: bloß kein Stress mit der Anreise! Deshalb entscheiden sich viele für einen Fastenurlaub in Deutschland, z.B. im Schwarzwald.
Doch warum Fasten im Schwarzwald?
Der Schwarzwald gibt sich als moderne touristische Region, wo man als Urlauber nicht nur beschaulich mit der Feldberg Sesselbahn den Berg herauf gleiten kann; Nein, Wandern und Mountainbiking, Wellness und Erholung prägen das touristische Angebot.
Die Höhen des Mittelgebirges ziehen viele Wanderer an und der weite Blick über die grünen Hügel bringt Labsal auf die gestresste Seele. So aktiv kann auch ein Heilfaster die Zeit sinnvoll nutzen. Die vielfältigen Wellness- und Freizeitmöglichkeiten kommen ebenfalls dem Fasten-Urlauber sehr entgegen.
Es sind nicht nur die Besichtigungen an den interessanten Orten, wie den vielen schönen Dörfern mit ihren schmucken Fachwerkhäusern, die auch den fastenden Urlauber mit großer Freunde erfüllen, denn hier kann er seine erhöhte Aufmerksamkeit, durchs Heilfasten gewonnen, zur eindrücklichen Verarbeitung der neuen Sichtweisen nutzen.
Fasten ist erfolgreicher und fällt leichter, wenn körperlicher Bewegung hinzukommt. Und das gelingt umso einfacher, je mehr die eindrucksvolle Landschaft und das angenehme Klima dies unterstützen. Und davon sprechen die Schwarzwald Besucher hinterher gerne.
Nicht zuletzt deshalb ist der Schwarzwald bei Wanderern und Mountainbikern so beliebt, weil er mit seinen abwechslungsreichen Tälern und Bergen den Fastenden nie langweilig wird; Sich hier zu bewegen und dennoch keine solche Höhen bewältigen zu müssen, dass die Kraftreserven zu schnell aufgebraucht werden, ist für viele Grund genug den Schwarzwald zu wählen.
Fasten im Schwarzwald? Aus dem Ja, warum nicht, kann Ja, aber genau dort werden.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Beitragsbild: fotolia.com
Dieser Beitrag wurde letztmalig am 02.08.2012 aktualisiert.