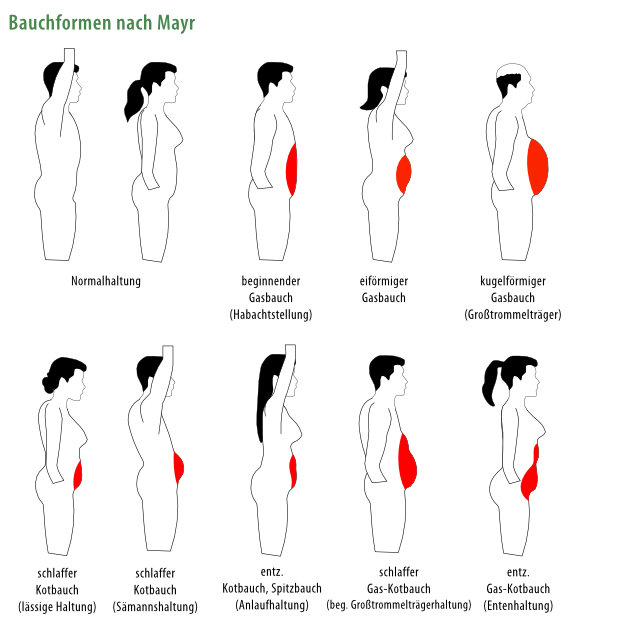Die Einen behaupten “Der Tod sitzt im Darm”. Das alleine sei schon Grund genug für eine Darmreinigung. Andere behaupten: Das mit der Darmreinigung sei völliger Unsinn.
Vielleicht haben Sie schon einmal so etwas Ähnliches wie eine Darmreinigung durchführen lassen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Vor einer Darmspiegelung wird der Darm vollständig entleert, und zwar mithilfe von Einläufen und Abführmitteln. Doch der Schulmediziner, der höchstwahrscheinlich der Darmreinigung kritisch gegenübersteht, verfolgt ja ein anderes Ziel.
Eine echte Darmreinigung hat natürlich einen anderen Sinn. Es ist auch gar nicht unbedingt erforderlich, einen Einlauf durchzuführen, denn es gibt auch andere Methoden. Die Reinigung des Darmes ist nicht nur Selbstzweck, sondern soll auch die Darmflora regenerieren: Zuträgliche Keime sollen sich vermehren und ungünstige Bakterien verdrängen.
Deswegen verbinden Naturheilkundler die Darmreinigung gerne mit einer Darmsanierung. Der Patient nimmt Bakterien-Kulturen zu sich, die die gewünschten Mikroben enthalten, die sich im gereinigten Darm eifrig vermehren. Sowohl die Darmreinigung als auch die Darmsanierung können auch unabhängig voneinander erfolgen. Doch ich empfehle immer die Abfolge: Erst die Darmreinigung, danach die Darmsanierung. Das eine bleibt ohne das andere immer nur Stückwerk.
Damit haben wir zwei Begriffe geklärt, die in der kontroversen Diskussion oft durcheinandergehen. Es ist nun auch klar, warum ich in einem Beitrag zur Darmreinigung auch die Darmsanierung darstelle.
Die Darmreinigung soll viele Wirkungen haben
Die gründliche Entleerung des Darmes befreit das Darmlumen von etlichem Unrat, der sich dort angesammelt hat. Dazu gehören Stoffwechselabfälle, die sogenannten „Schlacken“, Kotsteine, schädliche Bakterien und Pilze, besonders Candida, mikrobielle Toxine und Chemikalien aus der Nahrung. Das entlastet die Nieren und die Leber als die beiden wichtigsten Entgiftungsorgane. Die Darmschleimhaut erholt sich, auch weil entzündliche Prozesse eingedämmt werden. Die Darmreinigung regt daneben die Darmmuskulatur an, sodass sich die Darmperistaltik normalisiert. Sowohl chronische Durchfälle als auch Verstopfungen verschwinden.
Ganz nebenbei unterstützt die Darmreinigung auch das Abnehmen. Denn die reduzierte Kost, die immer dazu gehört, führt dem Körper weniger Kalorien zu. Die Therapie bekämpft Bakterien, die unverdauliche Ballaststoffe abbauen, die dann eine zusätzliche Kalorienquelle darstellen. Das Gewicht halten kann aber nur, wer die Ernährungsumstellung langfristig beibehält und so beispielsweise die unerwünschten Firmicutes-Stämme zurückdrängt.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Wann die Darmreinigung besonders zu empfehlen ist
Viele Menschen lassen eine Darmreinigung durchführen, um ihre Verdauungsprobleme loszuwerden. Verantwortlich dafür sind oft chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie das Leaky Gut Syndrom, Zöliakie, Morbus Crohn und Collitis ulcerosa. Im Zusammenhang damit stehen vielfach Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten gegen Gluten, Laktose und andere natürliche oder künstliche Verbindungen. Fettstoffwechselstörungen und Bluthochdruck sind eine weitere Indikationen für die Behandlung.
Von einem gestärkten Immunsystem versprechen sich viele Menschen auch, dass Atemwegserkrankungen nach einer Darmsanierung zurückgehen. Vielleicht haben viele zurückliegende Antibiotika-Medikationen die Darmflora derart angegriffen, dass die Krankheitserreger leichtes Spiel haben. Autoimmunkrankheiten sind ebenfalls ein Anlass, um eine Darmreinigung durchzuführen, weil die Körperabwehr mit dem Darm in engem Zusammenhang steht. Gelenkerkrankungen und Rheuma sollen auf die Darmreinigung ebenfalls gut ansprechen.
Mehr über die Zusammenhänge zwischen dem Darm und Ihrem Immunsystem lesen Sie in meinem Artikel: Immunstärkung durch das Darm-Immunsystem.
Die Beschwerden während der Wechseljahre sind für viele Frauen der Grund für eine Darmreinigung. Oft streben Menschen die Therapie an, weil sie ihre allgemeine körperliche und seelische Verfassung verbessern möchten. Viele wollen einfach nur Stoffwechselschlacken loswerden oder das Hautbild optimieren.
Eine kurze Sequenz aus meiner Online-Sprechstunde zum Thema „Darmsanierung verstehen„:
Ist die Wirkung der Darmeinigung wissenschaftlich nachgewiesen
Ob eine Darmreinigung per Einlauf eine effektive Therapie bei vielen Krankheiten ist, kann man aus wissenschaftlicher Sicht noch nicht klar beantworten. Auf einige Studien dazu ist anfangs schon hingewiesen worden. Im Beitrag: Was sagt die Wissenschaft zur Darmreinigung? habe ich ein paar Studien über die Darmreinigung zusammengestellt.
Was wir heute aber schon beantworten können, ist, dass diese Behandlungsform eine positive Antwort geben kann auf einige ernste und weniger ernste gesundheitliche Probleme.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung der japanischen Wissenschaftler (siehe Studien oben), dass die Darmreinigung einen positiven Einfluss auf das Immungeschehen zu haben scheint.
Wenn diese Beobachtung bestätigt werden kann, dann ergibt sich ein Behandlungsfeld für die Darmreinigung, wie es selbst die stärksten Befürworter dieser Methode nicht vermutet hätten.
Ohne unsere Darmflora hätten wir eine sehr eingeschränkte Abwehrfunktion gegen Krankheitserreger.
Woran liegt das?
Im Darm gibt es eine “Mikroflora” – die sogenannte Darmflora. Eine optimale Darmflora macht bei einem gesunden Menschen einen Großteil der körperlichen Abwehr aus. Der Darm ist ein Mikrokosmos ganz besonderer Art.
Er ist die Heimat von rund 500 verschiedenen Arten von Mikroben: Escherichia und Clostridium, Bacteroides und Pseudomonas, Bifidobacterium, Klebsiella, um nur einige zu nennen.
Die meisten dieser Mikroben verrichten sehr nützliche Aufgaben bei der Verdauung oder halten andere, schädliche Mikroben in Schach. Die Mikroben dürfen die Darmwand aber keinesfalls durchdringen und ins Innere des Körpers gelangen.
Wie kompliziert das Wechselspiel mit den bakteriellen Bewohnern ist, sieht man bei Säuglingen, bei denen sich die Darmflora erst mühsam – und oft unter Schmerzen aufbauen muss.
Später ist die Zusammensetzung der Darmbakterien zwar relativ stabil, ändert sich aber in gewissem Maß durch Veränderungen bei der Nahrung, Entzündungen oder andere Belastungen des Immunsystems.
Die Mikroben existieren besonders zahlreich im Dickdarm, in der unvorstellbaren Menge von bis zu 100 Milliarden und das in nur einem Gramm Darminhalt. Deshalb besteht der Stuhl auch zu mehr als einem Drittel aus abgestorbenen Bakterien.
Bestandteil einer vernünftigen Darmreinigung muss dementsprechend auch eine “Wiederaufforstung” sein.
Benötigt werden dazu mikrobiologische Präparate (sog. Probiotika) und auch eine Umstellung der Ernährungsweise.
Mehr über die Zusammenhänge zwischen dem Darm und Ihrem Immunsystem lesen Sie in meinem Artikel: Immunstärkung durch das Darm-Immunsystem.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Kann ich auch zu Hause eine Darmreinigung durchführen?
Schauen wir einmal auf die grundlegenden Arten der Darmeinigung, die zur Gesunderhaltung gedacht sind.
Da stellt sich die Frage, ob das Verfahren zu Hause oder in der Praxis des Heilpraktikers durchgeführt werden soll.
Wenn Sie sich für die Colon-Hydro-Therapie (CHT) entscheiden, ist die Antwort klar: fFür diese Darmreinigung müssen Sie in die Praxis, daheim haben Sie dafür gar nicht die technischen Möglichkeiten.
Der Therapeut leitet insgesamt bis zu 12 Liter einer Spüllösung (meist Wasser) in den Dickdarm und lässt sie im nächsten Arbeitsschritt durch den Schlauch wieder hinauslaufen. Der Vorgang wird einige Male wiederholt.
Als Spüllösung eignen sich verschiedene, mit Sauerstoff angereicherte Mischungen, denen noch Essig oder sogar Kaffee zugesetzt werden kann, um die Darmperistaltik anzuregen. Wobei ich anmerken muss, dass die Sache mit dem Kaffee-Einlauf noch ganz andere Wirkungen hat, die ich u.a. in meinem Buch: Die wundersame Wirkung des Kaffee-Einlaufs beschreibe.
Die CHT ist für Therapeut und Patient angenehm, weil die Spüllösung apparativ aufgefangen wird. Vorteilhaft sind hierbei sanfte Darmmassagen, die eine gründliche Reinigung unterstützen. Der Nachteil ist freilich, dass nur der Dickdarm gereinigt wird.
Einen Einlauf können Sie daheim selbst durchführen, allerdings erreichen Sie damit auch nicht alle Darmabschnitte, sondern nur den Mastdarm und den Dickdarm. Sie brauchen ein Instrument, um die angewärmte Spüllösung (31 bis 41 °C) in den Darm zu spritzen. Geeignet dazu sind Klistier-Spritzen oder Klistier-Bälle. Die Klyso-Pumpe ist allerdings effektiver. Diese Anwendung können Sie nur im Liegen durchführen. Die Reinigungslösung besteht aus Wasser, Kochsalz, Natron und Kamillen-Extrakt. Sehr wohltuend sind auch die Kaffee-Zusätze beim Kaffee-Einlauf.
Es geht auch ohne den „beliebten“ Einlauf
Der Einlauf scheint auf den ersten Blick die gründlichere Methode zu sein. Doch wenn Sie Ihren gesamten Gastrointestinal-Trakt reinigen möchten, nehmen Sie orale Präparate.
Diese Mittel bestehen aus zwei Hauptbestandteilen: Zum einen aus fein pulverisierten Flohsamenschalen (Wegerich, Plantago psyllium); die Ballaststoffe des Pulvers lösen “Schlacken” und helfen bei der Regeneration der Darmschleimhäute.
Die zweite Zutat ist eine mineralische Heilerde, entweder Bentonit oder Zeolith. Diese Pulver absorbieren dann die vom Flohsamenschalenpulver aufgenommenen Verunreinigungen, die in der gebundenen Form ausgeschieden werden können. Für die Darmreinigungslösungen gibt es Fertigpulver zu kaufen. Bentonit und Zeolith einerseits und Flohsamenschalen-Pulver andererseits werden auch als Kapseln angeboten. Diese Präparate erschweren allerdings die Dosierung, wenn sich herausstellt, dass Sie aufgrund von Unverträglichkeiten mit aufsteigenden Dosierungen vorgehen müssen.
Die Zubereitung erfolgt direkt vor der Einnahme, damit das Flohsamenschalen-Pulver das Getränk nicht zu stark andickt.
Mumijo ist die organische Alternative
Eine Alternative zu Bentonit und Zeolith ist das rein organische Mumijo. Die teerähnliche Substanz entsteht im Hochgebirge unter bestimmten, extremen Witterungsbedingungen. Wahrscheinlich ist intensive Sonneneinstrahlung bei der Entstehung des Rohstoffs ausschlaggebend. Als Ausgangssubstanz werden Pflanzenrückstände, aber auch Fledermauskot diskutiert. Abgebaut wird Mumijo im Himalaya und gehört deswegen zur ayurvedischen Medizin. Die Huminsäuren der schwarzen Droge binden Giftstoffe und harmonisieren die Darmschleimhaut.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Achten Sie auf wertvolle Rohstoffe
Ob Sie die Mittel für Ihre Darmreinigung selbst mischen oder fertige Zubereitungen kaufen: Wichtig ist vor allem eine zertifizierte Arzneimittelqualität und eine möglichst feine Körnung, die für eine große Material-Oberfläche sorgt. So können die schädlichen Verbindungen maximal absorbiert werden.
Schauen Sie daher genau hin, denn nicht alle diese Produkte sind aus meiner Sicht von “optimaler” Qualität. Teils enthalten die Präparate sogar Zusatzstoffe, die nicht sinnvoll sind, wie beispielsweise Magnesiumstearat. Überflüssig sind in diesen Produkten auch die Aminosäure Lysin.
Daneben können sich die Hersteller auch das Cranberry- oder Enzian-Pulver sparen. Solche Zutaten haben vielleicht wohlklingende Namen, sollen aber wohl nur als Preistreiber dienen.
Dennoch gibt es neben den unverzichtbaren Basis-Mitteln einige Wirkstoffe, die die Darmreinigung unterstützen. Dazu gehören Verbindungen, die Toxine absorbieren und auch solche, die den Stoffwechsel entsäuern.
Optionale Zusätze aus Pflanzen unterstützen die Darmreinigung
Das Trockenpulver der Algen Chlorella und Spirulina ist ein bewährtes Mittel zur Bindung und Ausleitung von Schwermetallen. Die Präparate in einer Dosis von 4 bis 5 Gramm täglich zu den Mahlzeiten einzunehmen, um eine Wirkung zu erzielen. Die in Fertig-Kapseln enthaltene Menge von rund 300 Milligramm ist viel zu gering.
Auch der Ballaststoff Konjak-Glucomannan ist der erst ab 3 Gramm pro Tag wirksam. Die Menge von 50 Milligramm in Darmreinigungs-Kapseln ist demgegenüber vernachlässigbar. Auch Kürbiskern-Pulver ist zwar sinnvoll, aber in den Fertig-Präparaten ebenfalls unterdosiert. Diese drei pflanzlichen Zusätze kaufen Sie am besten separat.
Gerstengras kann die Darmreinigung ebenfalls unterstützen, weil es einige positive Effekte auf den Darm ausübt. Die Säfte oder Pulver des Süßgrases wirken entzündungshemmend und sorgen dafür, dass sich die Darmschleimhaut von den Schäden durch Reizstoffe erholt. Harmonisierend wirkt Gerstengras auch auf die Säure-Base-Bilanz und den Wasseranteil des Stuhls, wodurch Verstopfungen kaum auftreten können. Die Säfte und Pulver können Sie in Smoothies, Salate und andere Speisen zu jeder Tagesmahlzeit einrühren.
Empfehlenswert sind Heilpflanzen-Extrakte, die den Darm beruhigen, Toxine absorbieren und Parasiten bekämpfen. Infrage kommen hier Koriander, Kamille, Anis, Pfefferminze, Oregano, Olivenblätter, Schwarzwalnuss-Schalen und Papaya-Kerne.
Pflanzen-Präparate mit Bitterstoffen helfen dabei, unerwünschte Keime aus der Darmflora zu beseitigen. Besorgen Sie sich Zubereitungen aus Löwenzahn, Artischocke, Mariendistel oder Brennnessel. Mit den Bitterstoffen unterstützen Sie auch die Leberfunktion und damit die Entgiftung des Körpers.
Ein anderes Rezept ist eine Mischung aus Äpfeln und Honig. Beides wird mit etwas Wasser im Mixer püriert. Dann hebe man noch Chiasamen und Leinsamen unter die Zubereitung, die nach einer viertel Stunde fertig sind. Dann sind die Körner genügend aufgequollen. Ihre Darmreinigungsmischung sollten Sie mindestens 3 Wochen lang täglich trinken. Nach jeder Anwendung nehmen Sie noch ein Glas Wasser zu sich.
Mit diesen mineralischen Zusätzen verstärken Sie die Darmreinigung
Sinnvoll sind basische Minerale wie Sango Meeres-Koralle, die Sie in einem Glas Wasser unterrühren und zum Essen einnehmen. Das Pulver trägt zur Regulation des Säue-Base-Gleichgewichts bei, weil es Calcium und Magnesium liefert. Empfehlenswert sind auch Mineralpräparate mit Silizium, Magnesium, Eisen, Zink und zusätzlichem Vitamin D3.
Wenn Sie speziell Schwermetalle ausleiten möchten, können Sie zusätzlich Chelate einnehmen. Diese, auch Komplex-Bildner genannten Verbindungen können pro Molekül mehrere Metall-Ionen einfangen. Für die Darmreinigung geeignet sind die Magnesium-, Kalium- und Calcium-Salze der Orot- und Zitronensäure. Die Präparate werden als Tabs oder Pulver zu den Mahlzeiten eingenommen.
Wie verläuft die Darmreinigung mit oralen Präparaten?
Beginnen Sie mit einer kleinen Dosierung. Mischen Sie dafür direkt vor der Einnahme einen halben Teelöffel Bentonit oder Zeolith und einen halben Teelöffel Flohsamenschalen-Pulver mit 200 ml Wasser. Ab dem zweiten oder dritten Tag können Sie die Menge auf einen ganzen Teelöffel steigern. Einige Hersteller legen auch einen Messlöffel der Packung bei, sodass Sie sich nach der Anleitung richten können.
Mischen Sie die Komponenten mit einem Pürierstab oder im Elektromixer, damit die Pulver nicht klumpen. Die mineralischen Pulver können Sie auch am Vortag ansetzen, sodass sie einweichen. Wenn dann das Flohsamenschalen-Pulver dazukommt, entstehen meistens keine Klumpen.
Trinken Sie die Lösung sofort nach der Zubereitung und zwar auf leeren Magen. Also eine halbe bis eine Stunde vor dem Essen oder zwei Stunden nach einer kleinen Mahlzeit. Wenn Sie Medikamente einnehmen müssen, tun Sie das drei Stunden vor oder nach der Einnahme Ihres Darmreinigungs-Präparates. Ansonsten könnten die Wirkstoffe absorbiert werden und Ihnen nichts mehr nützen.
Auf das Darmreinigungsmittel trinken Sie ein großes Glas (300 ml) stilles Mineralwasser. Diese Anwendung erfolgt zunächst einmal täglich, nach einer Woche zweimal täglich, am besten vor dem Frühstück und dem Abendessen. In der letzten Woche der Kur belassen Sie es wieder bei einer Anwendung. Drei Anwendungen sind nur bei einer längeren Kur über 8 Wochen empfehlenswert und in diesem Zeitraum nur während einer Woche. Wenn sie nur 14 Tage kuren, halbieren Sie die Dosierung pro Anwendung.
So können Sie auch mit einer Anwendung pro Tag gute Ergebnisse erzielen. Allerdings entgiften Sie um so schneller und wirkungsvoller, je höher Sie dosieren. Wenn Sie parallel zur Darmreinigung heilfasten, ist eine Woche mit drei Anwendungen täglich sehr sinnvoll.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Die Anwendung der Kapseln unterscheidet sich nur in einem Punkt: Sie sparen sich das Anrühren
Wenn Sie Kapseln nehmen, sind zwei Stück zweimal täglich in der ersten Woche und 4 Stück zweimal täglich ab der zweiten Woche ratsam. Das gilt sowohl für die Kapseln mit Bentonit und Zeolith als auch für die Flohsamenschalen-Kapseln. Die Zeitabstände zu den Mahlzeiten sind dieselben wie bei selbst bereiteten Trinklösungen. Nach der Kapsel-Einnahme trinken Sie zwei Gläser stilles Mineralwasser (insgesamt 400 ml).
Es gibt zahlreiche ähnliche Kurpläne, die auf 10 Tage bis zwölf Wochen ausgelegt sind. Es muss auch nicht so sein, dass man von vornherein die Dauer der Kur festlegt. Es ist durchaus empfehlenswert, mit einer Woche anzufangen und die Wirkung abzuwarten. Am Körperempfinden und der Stimmung spüren Sie den Erfolg. Dann können Sie die Kur verlängern, wenn Sie mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden sind.
Muss ich regelmäßig eine Darmreinigung durchführen?
Wenn Sie sich konventionell ernähren, ist eine Darmreinigung mindestens einmal, besser noch zweimal im Jahr empfehlenswert. Frühling und Herbst sind die günstigsten Zeitpunkte. Wenn Sie strikt auf gesunde Ernährung achten, kann eine Darmreinigung reichen. Das heißt, wenn Sie sich tendenziell vegetarisch mit Bio-Produkten ernähren und auf Zucker und Genussgifte verzichten. Sie können natürlich gelegentlich eine Trinklösung oder zwei bis vier Kapseln zu sich nehmen.
Die Darmreinigung ist abgeschlossen – nun folgt die Darmsanierung
Wenn Sie die Darmreinigung beendet haben, ist ein guter Zeitpunkt für eine komplette Darmsanierung gekommen. Nun kann auf dem Nährboden der gereinigten Darmschleimhaut eine gesunde Darmflora heranwachsen. Dazu können Sie Probiotika einnehmen, die optimal mehrere Stämme enthalten (z.B. Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum sowie die Hefe Saccharomyces boulardii). Für Menschen mit Histamin-Intoleranz haben Forscher spezielle Probiotika entwickelt (Probiotikum sensitiv, HistaEx Synio). Die darin enthaltenen Bakterien-Stämme helfen, Histamin zu metabolisieren. Probiotika werden während des Essens eingenommen.
Es gibt flüssige Probiotika und Kapseln, die auch das Präbiotikum Inulin enthalten (Combi Flora SymBIO). Ein Präbiotikum ist eine organische Verbindung, die das Gedeihen positiver Keime begünstigt. Ein beliebtes Präparat ist der Yacon-Sirup, der gleichzeitig eine leichte Süße ins Essen bringt und so die zuckerfreie Zeit erleichtert. Der Extrakt aus der Inkawurzel hat einen niedrigen glykämischen Index, sollte aber trotzdem sparsam verwendet werden. Präbiotika mischt man unter die Speisen.
In jüngerer Zeit sind die nährstoffreichen Postbiotika aufgekommen. Das sind abgetötete Bakterien und Pilze, die in lebendiger Form auch in Probiotika enthalten sind. Postbiotika sollen die Darmreinigung unterstützen. Ob die Präparate die Darmschleimhaut regenerieren können, ist schwer abzuschätzen. Zum Aufbau der Darmflora tragen die leblosen Mikroben natürlich nicht bei.
Die Darmreinigung ist der Einstieg in gesunde Ernährung
Die Darmreinigung und die Darmsanierung setzen zwar an einem Organ an, sollen aber dem ganzen Körper und auch der Seele gut tun. Deswegen sind beide Methoden ohne weitergehende Maßnahmen nicht sinnvoll. Hierzu gehört in erster Linie die Ernährung.
Wenn Sie sich weniger gesund ernähren und kurzzeitig eine Diät während der Darmeinigung einhalten, müssen Sie ihr Verdauungs-Organ bald wieder regenerieren. Daher ist die Darmreinigung dann am effektivsten, wenn die Ernährungsumstellung im Zuge der Therapie auch im Anschluss daran beibehalten wird.
Einige Lebensmittel sollten Sie während der Kur auf keinen Fall verzehren. Dazu gehören alle Nahrungsmittel, die dem Stoffwechsel eine hohe Säurelast bescheren. Verzichten Sie daher auf Zucker, Weißmehl, Milch und Milchprodukte, Schweinefleisch, jedwede Wurst, technisch denaturierte Lebensmittel sowie Kaffee und Alkohol. Fleisch vom Geflügel oder Rind sowie Fisch sollten während der Kur (und auch anschließend) höchstens zweimal wöchentlich auf den Tisch.
Ernähren Sie sich vorwiegend vegetarisch
Der Start in neue Ernährungsgewohnheiten bedeutet eine Hinwendung zur tendenziell vegetarisch ausgerichteten Kost. Gemüse, Salate und Kräuter sollten den Speiseplan bestimmen. Hülsenfrüchte liefern viel Proteine und glutenfreie Getreidesorten (Hirse, Mais) decken den Kohlehydrat-Bedarf.
Leckere Gerichte kann man auch mit Amaranth, Buchweizen und Qinoa zusammenstellen und durch andere Körnerfrüchte ergänzen. Dazu zählen Kürbiskerne, Leinsamen, Mandeln und Nüsse. Aus vielen Samen lassen sich vitalstoffreiche Sprosse heranzüchten wie die von Linsen, Weizen, Goldklee oder Radieschen.
Besonders während der laufenden Kur sollten nur wertvolle pflanzliche Öle zur Fettversorgung dienen. Also verzehren Sie am besten Öle von Oliven, Hanf, Lein und Walnuss.
Die Darmreinigung verläuft effektiver, wenn Sie an einem oder zwei Tagen in der Woche nur Gemüsesuppen oder Fruchtsäfte verzehren.
Auch während der Darmreinigung gilt: Trinken Sie ausreichend Flüssigkeit und zwar anderthalb Liter stilles Mineralwasser und einen halben Liter Kräutertee pro Tag.
Die Darmreinigung mit einer Darmsanierung ist ein ganzheitliches Konzept
Mit der Darmreinigung und Darmsanierung möchten Sie Ihre Gesundheit verbessern. Dazu gehören nicht nur körperliche, sondern auch seelische Aspekte. Beginnen Sie, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, mit täglichem Sport. Übertreiben müssen Sie es nicht, am besten passen Sie Sportart und Umfang Ihren persönlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten an. Schon 30 Minuten schnelles Spazierengehen kurbelt den Kreislauf an. Schwimmen ist ebenfalls eine gute Möglichkeit, um die Therapie zu unterstützen. Wem das nicht reicht, kann auch Muskeltraining oder fordernde Gymnastik-Arten betreiben.
Auch Behandlungen mit Massage-Bürsten fördern die Durchblutung. Bauchmassagen regen die Darmmuskulatur zu verstärkter Aktivität an.
Mit Entspannungsübungen können Sie etwas für Ihr seelisches Gleichgewicht tun. Die Psychosomatik lehrt uns, dass die Psyche einen großen Einfluss auf Körperfunktionen ausübt. Deswegen kann man ohne Weiteres unterstellen, dass Sie mit Meditation oder Autogenem Training auch die Darmreinigung und Darmsanierung unterstützen können.
Sie können die Darmreinigung auch mit anderen Therapien kombinieren
Am Ende einer Darmreinigung ist es sinnvoll, andere Organsysteme, die in der Entgiftung eine große Rolle spielen, einer reinigenden Therapie zu unterziehen,. Die Lymphgefäße transportieren Toxine, Krankheitserreger und Zelltrümmer aus den Geweben in den Blutkreislauf. Von dort strömen die Abfälle in die Leber.
Diese Prozesse fördern Sie, wenn Sie Lymphdrainagen durchführen lassen. Sehr von Vorteil ist auch eine Leberreinigung in Zuge der Darmreinigung. Eine andere Stoffwechselkur, die ich in diesem Zusammenhang empfehlen möchte, ist das Heilfasten. Auch dieses Programm harmoniert bestens mit der Darmreinigung und kann gut damit kombiniert werden.
Welche Risiken birgt die Darmreinigung?
Während der Darmreinigung kommt es durch die Entgiftung zu einer leichten Vergiftung. Was widersprüchlich kling, ist leicht erklärt. Die Entgiftung ist ja damit verbunden, dass Toxine im Körper freiwerden. Natürlich scheidet der Organismus die unerwünschten Stoffe auch wieder aus. Einige davon müssen aber erst die Leber durchlaufen und für die Exkretion vorbereitet werden. Diese Prozesse nehmen etwas Zeit in Anspruch. So kann es kommen, dass die Konzentration schädlicher Verbindungen im Körper vorübergehend ansteigt.
Bemerkbar macht sich das mit einigen Unpässlichkeiten wie Kopfschmerzen oder Hautunreinheiten. In diesen Fällen gehen Sie mit der Dosierung der Basis-Mittel herunter. Halbieren Sie beispielsweise die Menge Bentonit oder Zeolith und das Flohsamenschalen-Pulver. Wenn Verdauungsbeschwerden auftreten sollten, sind dies meistens Verstopfungen. Dann trinken Sie mehr Kräutertee.
In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte keine Darmreinigung durchgeführt werden. Es soll vermieden werden, dass die Leibesfrucht mit den ansteigenden Stoffwechselschlacken konfrontiert wird. Zudem ist die Darmreinigung anstrengend und würde eine schwangere Frau zu sehr belasten.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
In der Schulmedizin ist die Darmreinigung nur eine Vorbereitung auf die Darmspiegelung
Die gängige Ansicht der Schulmediziner hält sie nicht davon ab, selbst Darmreinigungen durchzuführen. Natürlich dient hier eine Darmreinigung nicht einer Prophylaxe gegen mögliche Erkrankungen, sondern als Vorbereitung auf eine Darmspiegelung oder eine Darmoperation.
Dazu werden Abführmittel und Einläufe eingesetzt, die nicht mit reinem Wasser durchgeführt werden, sondern mit Natriumphosphaten, Natriumsulfat (Glaubersalz) oder PEG (Polyethylenglykol, auch als Macragole bekannt). Die oral verabreichten Natriumphosphate wurden dann jedoch mit Nierenproblemen in Verbindung gebracht (1), sodass es heute eine Empfehlung gibt, diese Substanzklasse nicht mehr zu verwenden.
PEG (Polyethylenglykol) dagegen als orale Form der Darmreinigung durch Abführen ist bei den betroffenen Patienten nicht sehr beliebt, da der Geschmack der Substanz durchaus eine “Herausforderung” ist. Dazu kommt, dass PEG deutlich mehr Übelkeit verursacht als eine Natriumphosphat-Lösung (2).
Um bei einem PEG-Einlauf Elektrolytveränderungen zu begegnen, werden dem Einlauf Elektrolyte hinzugegeben. Elektrolytverschiebungen sind als Nebenwirkung von Natriumphosphat bekannt, wurden aber auch in erheblichem Maße bei Behandlungen mit PEG beobachtet (3).
Aber es gibt auch innerhalb der Schulmedizin kritische Stimmen, die selbst vor einer Darmoperation keinen Grund für eine Darmreinigung sehen. Aus Finnland kommt eine Arbeit, die eine rigorose Darmentleerung mittels Einläufen und/oder Abführmitteln ablehnt und stattdessen auf entsprechend sterile und präzise Operationstechniken als Lösung des Problems hinweist (4).
Weitere Themen zum Weiterlesen: Darmsanierung – Entgiften und Entschlacken – Symbioselenkung – Die Verdauung des Menschen und die Darmflora – Darmpilz Candida Albicans – Mikrobiologische Therapie – Hawaiianische Darmreinigung – Wissenschaftliche Studien
(1) siehe: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19675530
(2) siehe: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18396744
(3) siehe: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19895448
(4) siehe: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20402036
(5) gebräuchlicher ist der Cleveland Clinic Incontinence Score
Wenn Sie mehr zum Thema Darmreinigung erfahren möchten, können Sie hier unten kostenlos mehr Informationen anfordern. Tragen Sie dazu einfach Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse in die Box ein:
Im Folgenden noch eine Erfahrung eines Teilnehmers, der zur Gruppe der wenigen Personen gehört, die nicht fasten sollten, bzw. dies vorher abklären sollten. Herr Kerschgens hat aber die Maßnahmen zur Darmreinigung durchgeführt. Lesen Sie selbst:
BERICHT ZUR HEILFASTENANLEITUNG VON I. KERSCHGENS:
” (…) konnte ich trotzdem Ihre Informationen für die Darmreinigung nutzen, die ich als sehr angenehm empfand und dies mit einem eintägigen Safttag verbinden…”
Ich habe gerne und mit vollem Interesse Ihre Einführungen zum Heilfasten studiert. Da ich noch keine Ahnung mit Fasten und vor allem den Vorbereitungen dazu hatte, konnte ich viele für mich wichtige Informationen daraus ziehen.
Da ich dann aus Ihren Seiten erfahren habe, dass ich zu der Gruppe gehöre, die eher nicht fasten sollte, konnte ich trotzdem Ihre Informationen für die Darmreinigung nutzen, die ich als sehr angenehm empfand und dies mit einem eintägigen Safttag verbinden.
Jedenfalls danke ich Ihnen, dass sie sich diese große Mühe machen, um allen die Möglichkeit zum Fasten zu geben.
Mit freundlichen Grüßen
- Kerschgens“
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Dieser Beitrag wurde letztmalig am 23.2.2022 überarbeitet und ergänzt.