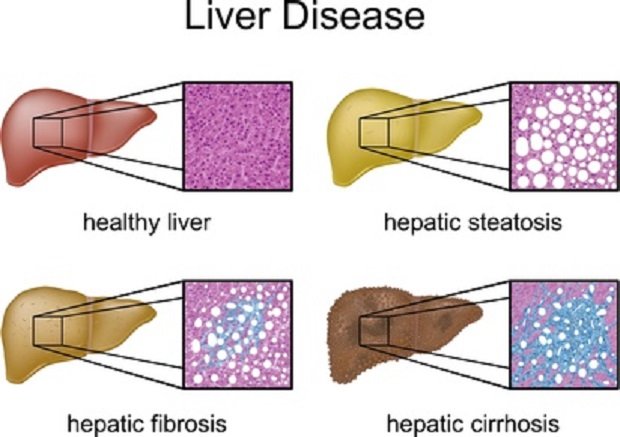Eine Hepatitis A ist eine infektiöse Gelbsucht (Leberinfektion) des Virustypen A.
Sie tritt weltweit auf, insbesondere jedoch in den Tropen. Erkannt wird die Hepatitis A meist an der Gelbfärbung der Sklera des Auges, die der Erkrankung den Namen „Gelbsucht“ einbrachte und an der sehr hellen Haut des Patienten.
Ursächlich für die Verfärbungen ist der Gallenfarbstoff (Bilirubin), der in der Leber nicht mehr richtig verarbeitet werden kann und in den Blutkreislauf übertritt.
Hepatitis A Viren werden durch engen, sozialen Kontakt wie Berührungen, durch bestimmte ungegarte Nahrungsmittel oder infiziertes Wasser übertragen. Erkrankte scheiden die Viren über den Darm aus. Auffällig ist ein bierbrauner Urin und ein sehr heller Stuhl.
Symptome
Bei Kindern, die sehr häufig von einer Infektion mit Hepatitis A Viren betroffen sind, verläuft die Erkrankung meist leicht und bleibt oft unbemerkt. Erkrankt jedoch ein Erwachsener, können im akuten Stadium Beschwerden wie Kreislaufprobleme, Übelkeit und Durchfall, allgemeine Schwäche oder/und psychische Reaktionen auftreten.
Verlauf
Eine Hepatitis A Infektion ist bei Erkrankungsbeginn immer ansteckend und führt oft zu einer mehrmonatigen Arbeitsunfähigkeit. Die Inkubationszeit beträgt zwischen zwei Wochen und zwei Monaten. Todesfälle, die sich auf eine Hepatitis A Erkrankung zurückführen lassen, sind sehr selten. Nach dem Abklingen der Erkrankung besitzt der ehemals Betroffene eine lebenslange Immunität, daher ist keine Impfung mehr nötig.
Diagnose
Wenn eine Hepatitis A vermutet wird, wird der behandelnde Arzt folgende Untersuchungen vornehmen:
- Messung der Temperatur
- Prüfung der Farbe von Urin und Stuhl
- Untersuchungen der Leber im Ultraschall
- Abnahme von Blut zur Bestimmung von Blut- und Leberwerten und zum Nachweis von Antikörpern (Anti HAV)
Therapie
Für eine Hepatitis A Erkrankung existiert keine spezifische Therapie.
Um jedoch etwaige Beschwerden zu lindern, sollten Patienten kreislaufstützende Maßnahmen, leichte Diät und Bettruhe einhalten. Es ist bei einer Infektion mit Hepatitis A dringend indiziert, auf den Genuss von Alkohol oder die Einnahme leberschädigender Medikamente zu verzichten, da diese den Verlauf der Erkrankung negativ beeinflussen könnten.
Um den Verlauf zu kontrollieren, sollten regelmäßig Laborwerte erhoben und der Allgemeinzustand überprüft werden. Auch nach einem Abfall der Werte in den Normbereich sollte weiterhin einige Monate eine fettarme Diät gehalten und auf Alkohol verzichtet werden, um das Risiko eines Rückfalls zu minimieren.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Prophylaxe und Impfung
Früher wurde durch die Gabe von Alpha-Globulinen eine Prophylaxe vorgenommen, die jedoch nur eine sehr begrenzte Wirkungszeit einiger Monate hatte. Heute sind Impfstoffe verfügbar, die einen mindestens 10jährigen Schutz bieten können, wenn das Impfprogramm konzentriert durchgeführt wird.
Zunächst erfolgt eine Injektion des Präparates in den Oberarm; schon hier tritt ein vollständiger Schutz gegen eine Infektion mit Hepatitis A ein, der jedoch zeitlich begrenzt ist. Um einen langjährigen Schutz zu erreichen sollte die Injektion nach 6 – 12 Monaten wiederholt werden.
Durch Gabe eines Kombinationsimpfstoffes kann auch gleichzeitig gegen Hepatitis A und Hepatitis B geimpft werden, nur muss die Impfung hier dreimal (zweite Impfung nach vier Wochen, dritte Impfung nach 6-12 Monaten) vorgenommen werden.
Hierzulande werden die Impfstoffe in der Regel sehr gut vertragen. Hat man jedoch schon einen natürlich erworbenen Schutz, ist eine Impfung überflüssig. Daher sollten über 50jährige, die sich impfen lassen möchten, zunächst vom behandelnden Arzt einen Antikörpertest vornehmen lassen.
Um sich vor einer Infektion zu schützen, sollten infizierte Lebensmittel oder Trinkwasser gemieden werden. Sind Nahrungsmittel gegart und Wasser abgekocht, besteht kein Risiko einer Infektion mehr.
Umgang mit Infizierten
Erkrankte sollten nur direkten Kontakt zu Menschen haben, die einen Impf- oder natürlichen Schutz gegen eine Infektion besitzen. Dennoch sollten auch hier folgende Maßnahmen ergriffen werden:
Vor allem sollte vermehrt auf Hygiene geachtet werde, insbesondere im Sanitär- und hier im Toilettenbereich. Da die Viren von den Betroffenen über den Darm ausgeschieden werden, ist häufiges und intensives Waschen der Hände (besonders nach dem Toilettengang) angezeigt. Auch sollten Hygieneartikel wie Seife, Bürsten desinfiziert und Handtücher täglich gewechselt werden.
Treten bei den pflegenden Personen die unter „Symptomen“ genannten allgemeinen Beschwerden auf, sollten diese umgehend selbst die Leber- und Blutwerte kontrollieren lassen, und die genannten Verhaltensregeln (Diät, kein Alkohol usw.) einhalten. Vom Erkrankten benutze Wäsche sollte ausgekocht werden.
Nachdem die Gelbfärbung der Skleren aufgetreten ist, sinkt die Ansteckungsgefahr rapide und ist nach wenigen Tagen gebannt.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Beitragsbild: fotolia.com – Tonpor Kasa