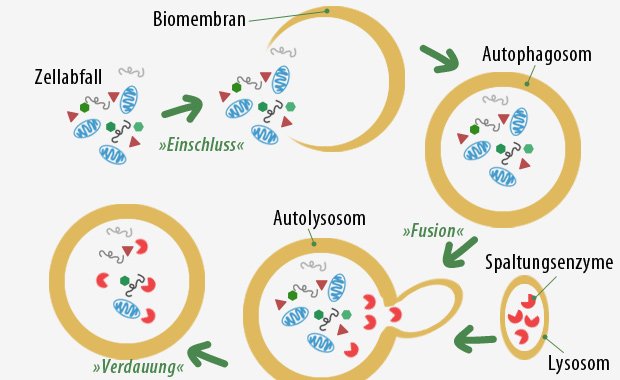Der Begriff „Darmsanierung“ ist in der Naturheilkunde und der Alternativmedizin in gewisser Weise etwas „strapaziert“ geworden. Im Zuge dessen ist auch die Abgrenzung zur Darmreinigung nicht immer klar. Wir verstehen hier unter einer Darmsanierung die Herstellung einer optimalen Darmflora. Obwohl die Darmreinigung schon das ihrige zu einer besseren Keimbesiedlung leistet, ist doch ihr vorrangiges Ziel die Beseitigung von schädlichen Stoffen. Das ideale Vorgehen besteht in einer Darmreinigung, auf die eine Darmsanierung folgt, wie ich es im Beitrag Darmreinigung: Kann man den Darm damit entgiften und entschlacken? beschreibe.
Eine kurze Sequenz aus meiner Online-Sprechstunde zum Thema „Darmsanierung verstehen„:
Fast wie ein „Modebegriff“ wird er in allen möglichen Zusammenhängen verwendet, oft ohne weitere Erklärung. In der Medizin bezeichnet man die Darmsanierung auch als Symbioselenkung. Die meisten Patienten, die in meiner Praxis erscheinen, haben wenig oder gar keine Ahnung, was sie sich unter einer Darmsanierung vorstellen sollen. Denn ihnen ist nicht bewusst, wie wichtig die Darmflora ist und wie leicht diese Keimbesiedlung durch schlechte Ernährung gestört wird. Diese „Symbionten“ (Symbiose: „Zusammenleben“) sind eifrige Helfer unserer Verdauung und der Körperabwehr.
Ganz uneigennützig tun sie dies nicht, denn wir stellen den Bakterien einen Lebensraum mit optimalem Milieu zur Verfügung. Dazu gehört auch, dass Konkurrenz ferngehalten wird. Und hier kann einiges aus dem Ruder laufen, sodass Keime Überhand gewinnen, die uns schaden und die „guten“ Keime zurückdrängen. Wenn das passiert, müssen wir den Lebensraum unserer Symbionten wieder in Ordnung bringen und Bakterien zuführen, die nützlich sind. Bevor allerdings die Population der nützlichen Helfer aufgestockt wird, geht es an die Reinigung.
So reinigen Sie den Darm
Bestimmt haben Sie schon von der Colon-Hydro-Therapie (CHT) gehört. Dabei wird in einer Naturheilpraxis der Dickdarm durchgespült. Angenehm ist dieses Verfahren deswegen, weil der Darminhalt mit einem Schlauch in ein Auffanggefäß gleitet wird. Die Spüllösung ist mit Sauerstoff angereichert und Essig oder Milch unterstützen die Lösung der Schlacken zusätzlich. Kaffee regt die Darmmuskulatur zu Bewegungen an, wodurch die Reinigung ebenfalls verbessert wird. Darmmassagen sorgen zudem für eine Lockerung der schädlichen Abfälle. Nachteilig bei der CHT ist hingegen, dass nur der Dickdarm gesäubert wird. Eine Alternative ist der zu Hause durchführbare Einlauf, der aber auch nicht als ideales Verfahren gilt.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Die Darmreinigung ohne CHT oder Einlauf
Am wirkungsvollsten ist die Einnahme einer speziellen Suspension mit 2 Grundbestandteilen: erstens die Ballaststoffe, die die Schlacken aus der Darmschleimhaut aufnehmen. Flohsamenschalen (Plantage psyllium, eine Wegerichart) in Pulverform sind hier das gängigste Mittel. Zweitens enthält die Reinigungs-Suspension eine Heilerde wie Zeolith oder Bentonit. Diese mineralischen Zusätze saugen die Schlacken aus den Flohsamenschalen auf wie ein Schwamm. Das ayurvedische Mumijo ist die bioorganische Alternative zu den anorganischen Heilerden. Die Huminsäuren des Präparates binden viele Toxine und lindern Entzündungen der Darmschleimhaut.
Jetzt sind die Abfälle gebunden und können ausgeschieden werden.
Die Präparate sind als gebrauchsfertige Produkte erhältlich, die aber nicht durchweg gut geeignet sind. Teils enthalten sie überflüssige Zusätze oder auch kontraproduktive Stoffe (Magnesiumstearat, Lysin, Calcium, Magnesiumoxid, Enzian, Cranberry). Sinnvolle Ergänzungen sind in den Produkten hingegen oft in zu geringen Mengen enthalten (die Algenpulver von Spirulina und Chlorella, der Ballaststoff Konjak-Glucomannan und Kürbiskern-Pulver). Da ist es besser, die Suspension selber anzumischen. Dazu nehme man ½ bis 1 Teelöffel Flohsamenschalen und dieselbe Menge Heilerde und vermische das Ganze in einem Glas Wasser.
Einzunehmen ist die Zubereitung auf leeren Magen. Das Pulver von Spirulina und Chloralla kann fakultativ in einer Dosierung von 4 bis 5 Gramm täglich hinzugefügt werden, daneben auch Bitterstoffe (als getrockneter Löwenzahn, Artischocke, Brennnessel). Diese sekundären Pflanzenstoffe helfen schon bei der Unterstützung einer positiven Keimbesiedlung. Andere Wirkstoffe beruhigen den Darm, wie etwa Papayakernpulver, oder getrocknete Brennnessel, Anis, Oregano, Olivenblätter, Pfefferminze und Koriander.
Zweiter Schritt: die Darmsanierung
Kontrastmittelaufnahme des Darms
Danach wird die Darmflora mit Probiotika aufgestockt. Die Präparate sollten mindestens 3 Stämme beinhalten: Lactobacillus acidophilus und casei sowie Bifidobacterium bifidum. Wichtig sind auch Präbiotika wie Inulin, das die „guten“ Keime im Wachstum unterstützt. Diese Präbiotika halte ich mittlerweile sogar für deutlich wertvoller und wichtiger als die Probiotika – zumindest für die große Mehrheit der Patienten.
Tatsächlich spielen ein gesunder Darm und eine Darmsanierung eine ganz besondere Rolle für Ihre Gesundheit.
Der Darm ist von der Veränderung bestimmter Eiweiße besonders betroffen, weil bei ihm die höchsten Zuckerkonzentrationen vorkommen. Das hat gravierende Folgen:
- Zum einen wird die Passage des Darminhalts immer schwerer, wodurch Verdauungsstörungen entstehen können.
- Zum anderen werden die Darmzotten an ihrer Aufgabe gehindert, die dem Nahrungsbrei entzogenen Nährstoffe aufzunehmen. Deshalb spielen die gezielte Darmreinigung und auch die Darmsanierung beim Fasten ja auch eine so große Rolle.
- Die Störung der Darmflora (Dysbiose) hat zur Folge, dass geeignete Symbionten zu wenig Butyrat aus Ballaststoffen produzieren. Das Salz der Buttersäure ist ein essenzieller Nährstoff für die Zellen der Darmschleimhaut und wahrscheinlich auch für das Gehirn. Butyrat kann eine beschädigte Darmschleimhaut auch reparieren (Gut Microbial Metabolite Butyrate and Its Therapeutic Role in Inflammatory Bowel Disease: A Literature Review).
Durch Ernährungsfehler und mentales „Aus-dem-Gleichgewicht-Sein” wird der Darm entscheidend behindert, seine lebenswichtigen Funktionen auszuüben. Anstelle der Entwässerung und Rest-Resorption des Nahrungsbreies ist er damit beschäftigt, Abfall zu beseitigen.
Eine kurze Sequenz aus meiner Online-Sprechstunde zum Thema „Darmsanierung verstehen“:
Der geschädigte Darm kann viele Krankheiten verursachen
Den Hilfeschrei des überlasteten Organs nehmen wir meist nicht mehr so direkt wahr. Wenn dann Krankheit als Ergebnis lang dauernder Vernachlässigung des Verdauungssystems unser Leben beeinträchtigt, konzentrieren wir uns auf die Beseitigung der Symptome, anstatt die Ursachen zu korrigieren.
Und so sind die meisten Darmkrankheiten Symptome und das Ergebnis dessen, was wir über Jahrzehnte „verdaut“ haben: Reizdarmsyndrom, Verstopfung, Blähungen, Darmträgheit, Hämorrhoiden, Darmentzündung und letztlich auch Darmkrebs könnten in vielen Fällen verhindert werden, wenn wir nur rechtzeitig auf dieses wichtige Organ und seine Bedürfnisse achten würden.
Auch Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und andere chronisch-entzündliche Darmerkrankungen haben oft mit einer Vernachlässigung des Darms, mit schlechter Ernährung und einer chronisch gestörten Darmflora, zu tun.
Wenn die Zellen der Darmschleimhaut zu wenig Butyrat bekommen, entstehen chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Zudem verliert der Darm an Dichtigkeit, sodass verstärkt Toxine und Mikropartikel aus dem Nahrungsbrei ins Blut übergehen (Leaky-Gut-Syndrom). Die Folge sind dann auch Entzündungsreaktionen des Immunsystems, wodurch einige chronische Krankheiten entstehen können. Weil so die Mitochondrien („Zellkraftwerke“) geschädigt werden, sorgt ein Mangel an Stoffwechselenergie für weitere Schäden. Das schränkt die Fähigkeit des Organismus’ ein, seine Selbstheilungskräfte zu mobilisieren.
Butyrat beeinflusst auch die Balance der Hormone, die für Sättigungsempfindung sorgen. Funktioniert der Mechanismus nicht mehr richtig, drohen Übergewicht und Diabetes.
Das Buttersäuresalz fördert die Apoptose in geschädigten Zellen. Wenn dieser programmierte Zelltod verzögert stattfindet, können die gealterten Zellen entarten. Der Untergang der gefährlichen Zellen kann die Krebsentstehung verhindern (Can butyrate prevent colon cancer? The AusFAP study: A randomised, crossover clinical trial).
Butyrat kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Offensichtlich brauchen die zerebralen Neurone den Vitalstoff, um sich gesund zu halten. Denn Menschen mit zu wenig butyratproduzierenden Bakterien in der Darmflora (Eisenbergiella und Eubacterium) leben mit einem höheren Alzheimerrisiko (Genetic correlations between Alzheimer’s disease and gut microbiome genera).
Eher zufällig unterhielt ich mich einmal mit einem befreundeten Chirurgen über dieses Thema. Er erklärte mir:
„Ein gesunder leerer Darm wiegt knapp 2 kg. Bei Obduktionen wurden Dickdärme gefunden, die über 20 kg wogen.“
Über die Zeit hat sich also bei diesen Personen eine unfassbare Menge an Verunreinigungen angesammelt, die nicht mehr abtransportiert werden konnte. Diese „Verschlackung“ in den vielen Vertiefungen und Taschen des Darms ist ein idealer Nährboden für Keime, Pilze, Würmer und sonstige Parasiten, die das Blut und die Lymphe belasten und dadurch das gesamte System erkranken lassen; eine chronische Unterwanderung der Gesundheit und Vitalität, die uns unterdessen fast normal und unvermeidbar erscheint.
Dass man sich bei einer solchen „Beschwerung“ schlapp, müde und krank fühlt, ist kaum verwunderlich. Auch die Lebensqualität und Lebensfreude hängen also (mehr oder weniger) direkt vom Zustand des Darms ab. Übrigens auch noch in einem weiteren Sinne: Der Darm reagiert oft auch empfindlich auf emotionale Probleme und Stress. Ärger, Angst und Sorgen machen dann Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme.
Leider muss ich hier auch noch erwähnen, dass die meisten Ärzte von diesen Fakten nichts wissen oder diese ignorieren und folglich von einer Darmsanierung auch nichts halten.
In der Zusammensetzung der normalen Stuhlflora (Darmbakterien) finden sich vor allem die Bifidusbakterien und Bakteroidesgruppen. Danach kommen erst die anderen Keimgruppen wie Lactobazillen, Enterokokken, Escherichia coli u.a.
Vermutlich tummeln sich in unserem Verdauungstrakt mehr als 1.000 verschiedene Bakterienarten. Insgesamt siedeln so viele Bakterien in unserem Darmsystem, dass deren Anzahl die unserer eigenen Körperzellen um ein Vielfaches übersteigt. Ging man lange Zeit davon aus, dass vor allem die genetische Veranlagung für den Ausbruch zahlreicher Darmerkrankungen maßgeblich sei, weiß man heute, dass die Darmgesundheit von vielen anderen Faktoren abhängt.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
So ist für eine optimale Gesundheit unter anderem das Gleichgewicht der Darmflora entscheidend. Zu einer Veränderung dieser Flora kommt es im Wesentlichen aus vier Gründen:
Gründe für eine Verschiebung des Darmmilieus
1. Abführmittel
Abführmittel verdrängen bei längerem Gebrauch die Lactobazillen und die Bifidusbakterien. Doch gerade diese beiden Bakterienstämme tragen durch ihre „Säuberungsaktivität“ zu einer verbesserten Darmmotilität (Bewegung) bei. Die Verringerung dieser Bakterienstämme zwingt zwangsläufig zu immer höheren Dosen an Abführmitteln: ein Teufelskreis. Eine naturheilkundliche Lösung sieht grundsätzlich Milchzucker und Kamillentee vor – natürlich darf keine Milchzuckerunverträglichkeit vorliegen.
2.Der chronische Durchfall oder „Schmierstuhl“
Vielen Patienten ist gar nicht bewusst, dass dies ein Problem sein könnte. Wenn Sie sich jedoch mehr als zweimal abputzen müssen, ist Ihr Stuhlgang zu weich und nicht optimal geformt. Ich meine nicht, wenn dies hin und wieder einmal vorkommt, sondern wenn dies fast immer der Fall ist. Ich kenne Patienten, die benötigen pro Stuhlgang eine Viertel Rolle Toilettenpapier. In diesem Fall kann man fast schon sicher sein, dass hier eine starke Dysbiose im Darm vorliegt. Mehr zu verschiedenen Problemen mit dem Darm lesen Sie unter: Darmprobleme und Darmstörungen
3. Antibiotika
Antibiotika werden immer noch zu häufig und viel zu schnell verordnet. Nicht nur dass wir uns damit die Resistenzen der Bakterien selbst heranzüchten (was viele Krankenhausärzte bereits fürchten), sondern Antibiotika tun vor allem eines: Bakterien töten. . Dabei unterscheiden sie nicht zwischen „bösen“ Bakterien, die Krankheiten verursachen, und „guten“ Bakterien, die wir im Darm dringend brauchen. Antibiotika töten sie ohne Unterschied ab. Und das tun auch oral (über den Mund) geschluckte Antibiotika: je nach Präparat mehr oder weniger.
Als mir der Leiter der Universitätskinderklinik Kiel im Jahr 2003 erklärte, dass er generell die Gabe von Antibiotika für Kinder bis zum 12. Lebensjahr als Infusion empfiehlt, fiel ich bald vom Glauben ab …
Seine Begründung war nämlich die Schädigung der Darmflora, die bei Kindern gravierender ausfällt als bei Erwachsenen! Alleine aus diesem Grund empfehlen selbst einige naturheilkundliche Ärzte eine Darmsanierung im Anschluss an eine Antibiotikatherapie, weil diese um die Zusammenhänge wissen.
4. Falsche Ernährung
Die Ernährung ist das Hauptproblem, das zu einem schlecht funktionierenden Darm führen kann: Falsche Zusammenstellung der Mahlzeiten, mangelhaftes Kauen, mehr Essen als verdaut werden kann, zu spätes Essen und natürlich zu viel Zucker überfordern den Darm und stören die Darmflora.
Gerade mit dem Zucker „füttern“ wir die Bakterienstämme und Pilze, die keine Helfer für uns sind, sondern Schmarotzer. Diese scheiden zudem noch Stoffwechselprodukte aus, die den Darm zusätzlich lähmen und auch in die Blutbahn übertreten können. Bei starker Vermehrung können diese Bakterien auch in den unteren Dünndarm wandern und dort Prozesse einleiten, die im Dünndarm absolut nicht erwünscht sind.
Ein gesundheitliches Problem, das in diesem Zusammenhang zu wenig Beachtung findet, ist das Problem der Darmpilze. Oft unbemerkt besiedeln Pilze den Darm und sorgen dort für teilweise gravierende Probleme. Welche Auswirkungen das auch auf Ihr Immunsystem hat, habe ich in einem Blog-Beitrag beschrieben: Immunstärkung durch das Darm-Immunsystem.
Auch verwerten die Bakterien unserer Darmflora schwer verdauliche Zucker unterschiedlich gut. Einige Mikroorganismen zerlegen die Kohlenhydrate in Einzelbestandteile, die wir dann aufnehmen können, statt sie einfach unverdaut wieder auszuscheiden. In Ländern, in denen das Nahrungsangebot knapp ist, sind diese Darmbakterien hilfreich und sinnvoll. Sind bei einem gleichzeitigen Überangebot an Kohlenhydraten hingegen vornehmlich solche Bakterien im Darm vorhanden, so kommt es leicht zur Fettleibigkeit, mit den vielen schädlichen Folgen für Ihre Gesundheit.
Die Schulmedizin kommt in manchen Fällen als weiteres Problem hinzu: Haben sich Pilze, schädliche Bakterien oder andere gefährliche Organismen im Darm angesiedelt, werden diese oft mit brutalen Methoden ausgemerzt: Antibiotika und Antimykotika sorgen jedoch auch für großen Schaden bei den „gesunden“ Mikroorganismen. Die Gefahr, dass sich die schädlichen Organismen danach schnell wieder ausbreiten können, ist sehr hoch.
All diese (und noch einige weitere) Gründe können dafür sorgen, dass die Darmflora gestört ist und der Darm seiner Arbeit nicht mehr vollständig nachgehen kann. Das hat Auswirkungen auf den ganzen Körper. Mit einer Darmsanierung können Sie die Darmfunktion wieder verbessern.
5. Butyratmangel
Das Thema Butyratmangel hängt eng mit dem Punkt „Ernährung“ zusammen. Butyrat ist für einen gesunden Stoffwechsel erforderlich ist. Die kurzkettige Fettsäure nehmen wir nicht nur mit Butter auf, sondern wird auch von Bakterien der Darmflora produziert. Butyrat ernährt die Darmschleimhaut, die sonst verkümmern würde, und stellt Studien zufolge auch einen wichtigen Vitalstoff für das Gehirn dar.
Darmsymbionten, die uns mit Butyrat versorgen, können nur auf optimalem Substrat gedeihen. Dazu müssen wir den Symbionten ein breites Spektrum an Ballaststoffen bereitstellen. Denn davon ernähren sich Bakterien wie die Arten aus der Gattung Roseburia sowie Faecalibacterium prausnitzii. Neben der Qualität der unverdaulichen Stoffe spielt auch die Menge eine Rolle: Weniger als 300 Gramm täglich sollten es nicht sein!
Mikrobiologische Mechanismen und Konsequenzen einer Darmsanierung
Zentraler Bestandteil einer Darmsanierung ist der Neuaufbau bzw. die Normalisierung der Darmflora. Klar ist jedoch: Bevor dieser Neuaufbau in Angriff genommen werden kann, müssen über andere Maßnahmen günstige Bedingungen geschaffen werden.
Denn es nutzt nichts, die Darmflora neu aufforsten zu wollen, ohne den entsprechenden „fruchtbaren Boden“ dafür bereitzustellen. Dieser „fruchtbare Boden“ bzw. diese günstigen Bedingungen werden über eine entsprechende Ernährungsmodifikation, Darmreinigung usw. hergestellt, um sicherzugehen, dass die Noxen, die für die entgleiste Darmflora verantwortlich sind, ausgeschaltet sind. Sonst haben Sie nämlich auch nach einer Darmsanierung Ihre alten Probleme ganz schnell wieder. Nötig ist also in vielen Fällen eine Ernährungsumstellung, um den Darm zu entlasten.
Eine gesunde Ernährung mit den allgemeingültigen Empfehlungen (möglichst naturbelassene Lebensmittel, wenig Zucker, wenig Fleisch, wenig ungesunde Fette, dafür viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte) ist die Basis. Hilfreich können außerdem naturbelassene Joghurts und Kefir sein, die günstige Keime für die Darmflora liefern. Fermentiertes Gemüse schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Es ist Pro- und Prebiotikum zugleich. Neben zuträglichen Bakterien sind darin auch reichlich Ballaststoffe enthalten, die den butyratproduzierenden Keimen einen guten Nährboden bieten.
Kimchi und Sauerkraut gehören daher zu einer guten Ernährung und einem gesunden Darm hinzu. (Aber Achtung: Billiges Sauerkraut ist oft nur mit Essig angemacht, um es vom Geschmack her ähnlich zu machen. Echtes, durch Gärung gesäuertes Kraut enthält dagegen viele wichtige Vitamine, außerdem Milchsäure und Bakterien, die dem Darm helfen.) Außerdem ist eine Entgiftung wichtig, um den Darm zu entlasten.
Im Mikrobiom des Darmes sind auch stets solche Bakterien anzutreffen, die wir nicht haben wollen. Diese pathogenen Keime gilt es zurückzudrängen, zugunsten gesundheitsfördernder Bakterienstämme. Dieses Gleichgewicht in der Darmflora erreichen wir mit einer abwechslungsreichen Zusammensetzung unserer Ernährung, die die verschiedensten Ballaststoffe beinhaltet. Obst und Gemüse gehören dazu und namentlich die Hülsenfrüchte wie Bohnen. Resistente Stärke erhalten wir aus weißem Reis und Kartoffeln, Kürbis und Süßkartoffeln. Vollkornprodukte sind ebenfalls sinnvoll, aber wegen der darin vorkommenden „Anti-Nährstoffe“ (Gliadin, Lectine, Weizenkeimagglutinin) nur in geringem Maße.
Um Darm und Darmflora nicht zu überfordern, sollte eine Ernährungsumstellung nach und nach erfolgen. Ein stark belasteter Darm sollte erst einmal zwei Wochen mit einer Glucoselösung umgewöhnt werden. Dieses „Dextrosewasser“ wird über den Tag verteilt getrunken. Ist diese Kur beendet, kommen Gemüse mit geringem Stärkeanteil in Frage, wie Aubergine, Fenchel, Kohl und Spargel. Nach weiteren 14 Tagen sind Reis, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Kürbis und Pastinaken sowie Obst, beziehungsweise Fruchtfleisch und Obstsaft, „erlaubt“.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Probiotika gezielt einsetzen
Eine Aufforstung mit nützlichen Bakterien sieht zu Beginn recht einfach aus: Man nehme nützliche Bakterienstämme in Form von Probiotika-Kulturen, unterstütze das Ganze noch mit der Einnahme von Präbiotika, also im Wesentlichen Ballaststoffen, und schon ist die neue Kultur gepflanzt und kann sich munter fortpflanzen. Allerdings steckt der Teufel auch hier im Detail bzw. in der Praxis. Probiotika-Kulturen haben eine enorme Anzahl an bioaktiven Mikroorganismen.
Der Darm dagegen hat eine Population, die milliardenfach höher liegt (bis zu 1015, gesprochen 10 hoch 15 = 1.000.000.000.000.000 Bakterien). Probiotika dagegen nehmen sich wie der Tropfen auf dem heißen Stein aus. Daran ändert auch eine wiederholte Einnahme dieser Präparate nichts. Wenn dann nämlich die Einnahme der Probiotika unterbrochen wird, dann dauert es auch nicht sehr lange und man kann keine dieser Kulturen mehr im Darm nachweisen. So wie es aussieht, lässt die unglaublich hohe Zahl der vor Ort ansässigen Darmbakterien eine Ansiedlung von „Neuankömmlingen“ nicht zu. Das ist gut und schlecht: schlecht für unseren Zweck, eine neue Flora aufzubauen, aber gut, da dieses Biosystem so stabil zu sein scheint, dass es nicht so ohne weiteres von externen Einflüssen umgeworfen werden kann. Auf dieser Stabilität beruht nicht zuletzt auch unsere Darmgesundheit.
An dieser Stelle stellt sich die Frage, wenn ich über meine Probiotika nicht das erreichen kann, was ich will, nämlich die Einflussnahme in Richtung neue Darmflora, macht dann eine Therapie mit Probiotika überhaupt noch Sinn?
Oder: Wenn Darmsanierung ein erfolgreiches therapeutisches Konzept ist, was passiert denn dann im Darm unter dem (spärlichen) Einfluss der Probiotika auf die Ausbildung einer neuen Flora? Gibt es überhaupt einen gesundheitlichen Nutzen?
Es gibt einen Effekt, der aber überraschenderweise in einem vollkommen anderen „Fachgebiet“ zu suchen ist, der Immunologie. Denn die Darmsanierung hat einen ausgesprochen positiven Effekt auf die immunologischen Vorgänge im Darm. Diese Vorgänge zeigten sich in Studien als so differenziert, dass man nicht nur von einer einfachen „Stärkung des Immunsystems“ sprechen konnte, sondern von einer „immunmodulierenden“ Wirksamkeit.
Immunmodulation bedeutet vereinfacht ausgedrückt, dass hier das Immunsystem gestärkt wird, wenn es schwächelt, und dass es umgekehrt gebremst wird, wenn es überschießt, wie zum Beispiel bei Allergien oder Autoimmunerkrankungen. Das heißt letztendlich, dass es einen Mechanismus geben muss, der erkennt und entscheidet, was mit dem Immunsystem geschehen soll. Denn eine Immunstärkung bei einem überschießenden Immunsystem macht keinen Sinn bzw. ist potenziell gefährlich für den Betroffenen, der dadurch in ein anaphylaktisches Ereignis geraten könnte. Dieser regulierende Mechanismus kann über eine Darmsanierung angeregt oder wiederhergestellt werden.
Die immunologische Trickkiste der Darmsanierung
70 Prozent und mehr der Immunzellen unseres Körpers sind im Darm lokalisiert. Der Darm stellt noch vor der Haut die größte Grenzfläche des Körpers zur Außenwelt dar, obwohl er im Körper liegt. Grund ist die immense Oberflächenvergrößerung, die durch die Millionen Darmzotten entsteht. Somit ist der Darm als immunologischer Dreh- und Angelpunkt ein optimaler Ansatzpunkt für immunmodulatorische Maßnahmen. Und dies erfolgt gleich auf verschiedenen Ebenen:
Unspezifische Immunreaktion
Das unspezifische Immunsystem des Darms liegt überwiegend im Dünndarmbereich und dort in den Peyer-Plaques. Dies sind Zusammenschlüsse von Lymphfollikeln und Teil des GALT (gut associated lymphoid tissue) oder Darm-assoziiertes lymphatisches Gewebe. Diese Follikel bestehen aus einer Ansammlung von Zellen des erworbenen Immunsystems, die für die Abwehr von Infektionen und die Verbreitung von immunologischen Informationen zuständig sind.
Ein weiterer Bestandteil dieses unspezifischen Immunsystems sind Epithelzellen, die M-Zellen (Microfold-Zellen), die ebenfalls im Dünndarm (vor allem im Ileum), aber auch in den Tonsillen vorkommen. Sie stehen im engen Kontakt zu den Peyer-Plaques, funktionell wie örtlich. Diese M-Zellen nehmen einen Teil der durch den Darm passierenden Fremdstoffe auf und präsentieren „ihren Fund“ den immunkompetenten Zellen. Wie schon angedeutet, leisten die Peyer-Plaques bei der Verbreitung der immunrelevanten Informationen entscheidende Hilfe.
Auf diese Weise erfährt das Immunsystem durch die in der Nahrung usw. enthaltenen Stoffe ein tägliches Training in Sachen Aufbau und Neujustierung der eigenen Abwehrlage. Jede Mahlzeit ist somit nicht nur eine Sicherstellung von Energien für den Organismus, sondern gleichzeitig ein Trainingsprogramm für das Immunsystem. (Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass Kinder, die unter zu „hygienischen“ Bedingungen aufwachsen, oft ein schwächeres Immunsystem haben. Ihr Körper kommt im Alltag nicht mit genügend Stoffen in Berührung, die das Immunsystem anregen.)
Wie weitreichend die Darmflora unser Immunsystem beeinflusst, zeigt sich sehr deutlich nach Impfungen. Während bei dem einen nach einer Grippe-Impfung der Körper gegen die gefährlichen Keime gewappnet ist, ist bei dem anderen überhaupt keine Schutzwirkung festzustellen. Wissenschaftler konnten nun am Mausmodell zeigen, dass dies entscheidend von der Darmflora abhängt. Wachsen die Tiere nämlich in einer keimfreien Umgebung auf oder wurde durch Antibiotikagabe ihre gut ausgebildete Darmflora stark dezimiert, so bildet ihr Immunsystem viel weniger Antikörper gegen die Grippe-Erreger als bei Nagern mit gesunder Darmflora. Dieses Phänomen lässt sich, laut den Wissenschaftlern, durch die fehlende Stimulierung der Immunantwort begründen (TLR5-mediated sensing of gut microbiota is necessary for antibody responses to seasonal influenza vaccination).
Anhand von menschlichen Stuhlproben lässt sich für unterschiedliche Immunisierungen beweisen, dass die bakterielle Besiedelung des Verdauungstraktes die Wirksamkeit der Impfung stark beeinflusst (unter anderem gegen Rotaviren, Tetanus, Tuberkulose und Polio), (Stool microbiota and vaccine responses of infants).
Für unsere Darmsanierung durch mikrobiologische Präparate heißt dies, dass es auch hier über die M-Zellen zu einer Immunreaktion auf die nützlichen Bakterien kommt. Und diese Immunreaktion erfolgt unabhängig von der Höhe der Bakterienzahl. Sie würde auch bei nur sehr wenigen Bakterien einsetzen. In diesem Fall erfährt das Immunsystem eine Stärkung seiner Leistungsfähigkeit, da die Zufuhr der Probiotika eine Reihe von Immunprozessen „lostritt“:
- Aktivierung von Makrophagen und deren Proliferation
- Aktivierung und Steigerung von natürlichen Killerzellen
- das Gleiche gilt für die Granulozyten
- Verstärkung von humoralen Abwehrfaktoren wie Opsonin und Komplement
- über Makrophagen stimulierte Aktivierung von Lymphozyten
- verstärkte Interferonbildung
- Aufbau einer Keimkonkurrenz und Antibiose
Die Immunaktivität wird ausbalanciert
Auffällig ist hier, dass die Stärkung des Immunsystems nicht über eine Erhöhung von Antikörpern erfolgt. Denn dies würde für Allergiker verhängnisvolle Folgen haben. Der ganze Vorgang erfolgt immer dann, wenn Substanzen von den M-Zellen erfasst werden.
Es ist dabei gleichgültig, ob es sich um Erreger, Antigene oder nützliche „Sachen“ handelt, die Information für das Immunsystem wird auf jeden Fall erstellt. Damit haben wir einen ersten Eindruck, warum die Immunstärkung auf einer Modulation und nicht auf einer einfachen, „plumpen“ Ankurbelung der Faktoren beruht, die auch für die Allergie mit zuständig sind. Dies gibt dem System die Gelegenheit, im Falle einer Allergie oder prinzipiell überschießenden Immunsystems Gegenmaßnahmen zu ergreifen, ohne die oben aufgeführte Aktivierung unterbrechen zu müssen.
Probiotika sind nämlich bekannt dafür, dass sie allergische Neigungen beseitigen, was in diesem Fall über die Normalisierung der Th1-/Th2-Immunbalance erfolgt. Denn bei allergischen Prozessen liegt in der Regel ein Übergewicht der T-Helferzellen Typ 2 vor. Eine Normalisierung, die die Probiotika einleiten können, führt zur Beseitigung dieser überschießenden Reaktionen.
Spezifische Immunreaktion
Bei dieser Immunreaktion treten erstmals Antigene in den Vordergrund. Hier wird über eine antigenspezifische Aktivierung von B- und T-Lymphozyten eine systemische Immunantwort provoziert. Auch hier spielen die M-Zellen eine Schlüsselrolle. Bei oraler Aufnahme von Substanzen werden über die M-Zellen als Verteiler die B-Lymphoblasten aktiviert, die aus dem Darm in den Blutkreislauf gelangen und auf die an anderen Orten im Organismus befindlichen Schleimhäute übergehen (Bronchialschleimhaut, Vaginalschleimhaut, Nasen-Mundschleimhaut usw.). Aber auch die Darmschleimhaut bleibt von diesem Effekt nicht „verschont“: Ein Teil der Lymphoblasten kehrt in den Darm zurück („Homing-Effekt“).
Auf den verschiedenen Schleimhäuten reifen diese dann zu Plasmazellen, die einen spezifischen Schleimhaut-Antikörper produzieren, IgA (Immunglobulin A). Diese Antikörper werden in die Schleimhäute eingebunden und bilden somit einen Antikörper-„Mantel“ gegen bakterielle Angriffe. Hier spielt die Spezifität der Antikörperbildung eine bedeutsame Rolle, denn es sollen keine nützlichen Bakterien, wie zum Beispiel die aus den probiotischen Präparaten, vernichtet werden.
In dieser Eigenschaft sind sie in der Lage, unter Umgehung von kontraproduktiven Entzündungsprozessen die Adhäsion und Invasion von Bakterien, Viren und anderen unerwünschten Substanzen zu verhindern. Dazu gesellt sich die Fähigkeit dieses „Setups“, Allergene zu erkennen und zu binden. Diese Schutzfunktion ist bei Allergikern nur unzureichend ausgebildet.
Wie signifikant diese Beobachtungen sind, zeigt sich in Arbeiten, die nachweisen konnten, dass Asthmatiker drei bis viermal häufiger einen IgA-Mangel in den Schleimhäuten aufwiesen als gesunde Probanden. In der „Praxis“ konnte dies erstmals in einer finnischen Studie aus dem Jahr 2001 gezeigt werden (Probiotics in primary prevention of atopic disease: a randomised placebo-controlled trial).
In dieser Studie wurden Müttern und Neugeborenen mit einer Atopie in der Familiengeschichte (das ist eine Überempfindlichkeit der Haut und der Schleimhäute, die in Familien gehäuft vorkommen kann) oral Probiotika verabreicht. Diese Maßnahme reduzierte signifikant die Ausbildung von atopischen Ekzemen bei den Neugeborenen. Der Effekt wurde mit der verstärkten Ausbildung von schleimhautgebundenem IgA im kindlichen Darm erklärt.
Wie es aussieht, kann die Frage, ob eine Darmsanierung Humbug oder sinnvoll ist, nur folgendermaßen beantwortet werden: Es gibt kaum etwas Sinnvolleres.
Obwohl die Probiotika keinen ausschlaggebenden Effekt auf eine Neubesiedlung der Darmflora haben, scheint dieser Effekt dennoch auf Umwegen erreichbar zu sein. Denn die Gabe von Probiotika stimuliert und rejustiert das Immunsystem, über dessen Schiene eine verstärkte Bekämpfung von nicht erwünschten Substanzen und Mikroorganismen zustande kommt.
Und nicht nur unser Immunsystem wird von der Darmflora entscheidend beeinflusst. Studien zeigen, dass eine negative Veränderung der mikrobiellen Zusammensetzung in unserem Verdauungstrakt zu entzündlichen Darmerkrankungen, Übergewicht, Lebensmittelallergien, Diabetes und Stimmungstiefs führen kann (unter anderem beschrieben in: Altering the intestinal microbiota during a critical developmental window has lasting metabolic consequences, Differences in the gut microbiota of healthy children and those with type 1 diabetes, Dietary emulsifiers impact the mouse gut microbiota promoting colitis and metabolic syndrome, Commensal bacteria protect against food allergen sensitization.
Fäkaltransplantation
Einige Mediziner sind dazu übergegangen, ihre Patienten mit einer sogenannten Bakterientherapie (oder auch Fäkaltransplantation) zu behandeln. Sie führen den Stuhl gesunder Spender mithilfe eines Einlaufs in den Darm ihrer Patienten ein. Hierdurch sollen die günstigen Bakterien rasch die Krankheitserreger verdrängen. Die Ergebnisse sind, laut den Anwendern der Therapie, äußerst vielversprechend.
In Deutschland wird die Methode bisher allerdings nicht angewendet. Zu unüberschaubar scheinen die möglichen Risiken. Schließlich wird der Fäzes der Spender nur auf wenige Keime hin kontrolliert. Infektionen sind daher kaum auszuschließen.
Welch weitreichende Veränderung des gesamten Organismus durch eine so groß angelegte Umgestaltung der Darmflora möglich ist, kann bisher ebenfalls kaum abgeschätzt werden. Schließlich wirkt sich die Zusammensetzung der Darmflora auf den Stoffwechsel, die Psyche und das Immunsystem aus. Größere Langzeitstudien zu der Therapie liegen noch nicht vor.
Zurzeit wird versucht, nur die gewünschten Bakterien aus dem Stuhl der Spender zu extrahieren, um Infektionen zu verhindern und die Bedingungen möglichst konstant zu halten. So lässt sich auch der zugegebenermaßen bestehende Ekel überwinden, der sicherlich viele bei der Vorstellung überkommt, fremden Kot in den eigenen Darm zu spülen. Aus meiner Sicht gibt es „angenehmere“ Varianten, die Darmflora zu verbessern.
Wie man eine Darmsanierung im Rahmen einer Fastenkur gestalten kann, erfahren Sie in meiner Heilfasten-Anleitung.
Ebenfalls wichtig zum Thema: Darmsanierung bei Babys und Kleinkindern
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2025 aktualisiert.